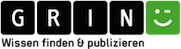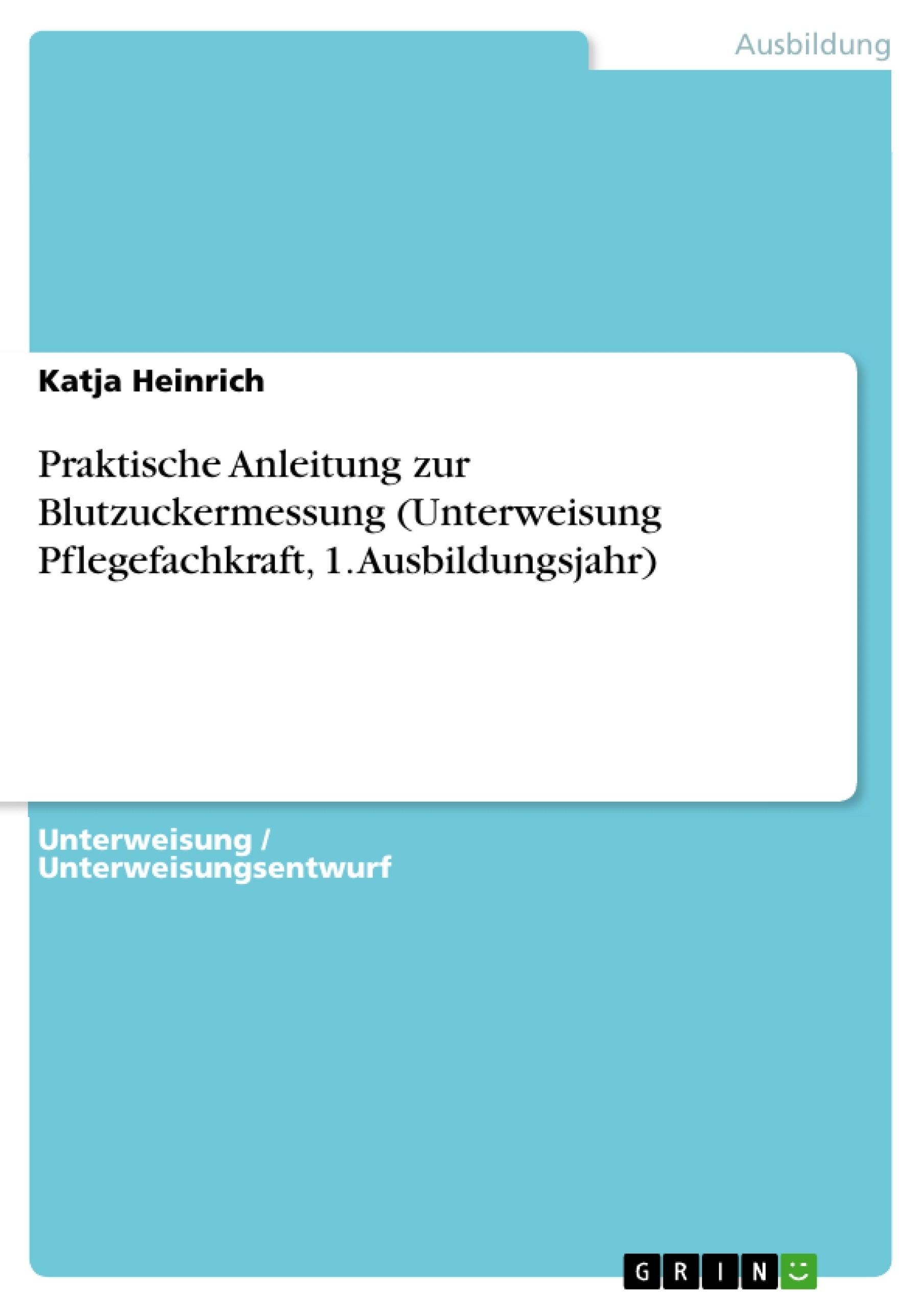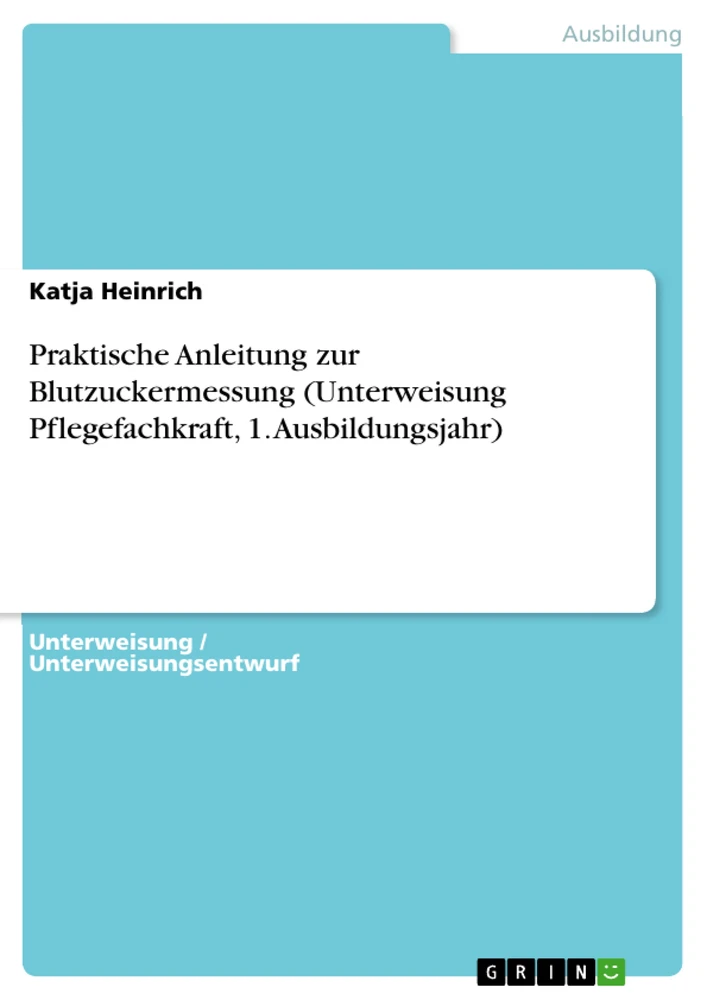
Praktische Anleitung zur Blutzuckermessung (Unterweisung Pflegefachkraft, 1. Ausbildungsjahr)
Unterweisung / Unterweisungsentwurf, 2023
20 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema der Facharbeit
- Begründung der Themenauswahl
- Bedingungsanalyse
- Stations- und Arbeitssituation
- Analyse der Lernenden
- Lerntyp der Lernenden
- Patientenanalyse
- Sachanalyse
- Inhaltsanalyse
- Lernzielformulierung
- Richtziel
- Grobziel
- Feinziel
- Anleitungsplanung
- Voraussetzung
- Methodenauswahl
- Medienauswahl
- Umsetzung der Vier-Stufen-Methode
- Aufgabenplanung des Praxisanleiters
- Durchführung der Praxisanleitung
- Auswertung der Anleitung
- Selbstbewertung der Lernenden
- Bewertung durch den Praxisanleiter
- Evaluationsgespräch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der Praxisanleitung einer Lernenden in der Pflege, um die korrekte Messung des Blutzuckerwerts an der seitlichen Fingerkuppe zu erlernen. Die Arbeit zeigt die Planung und Durchführung einer fiktiven Anleitungssituation anhand des neu erlernten Wissens der Weiterbildung zum Praxisanleiter. Der Fokus liegt auf der Vermittlung des theoretischen und praktischen Wissens sowie der Entwicklung der Kompetenz der Lernenden, den Blutzuckerwert zu messen, zu deuten und entsprechend pflegerisch professionell zu handeln.
- Praxisanleitung zur Blutzuckermessung
- Vermittlung von Theorie und Praxiswissen
- Entwicklung der Kompetenz der Lernenden
- Analyse der Lern- und Arbeitssituation
- Einsatz von Anleitungsmethoden und -materialien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Facharbeit vor: die Praxisanleitung einer Lernenden in der Pflege zur korrekten Messung des Blutzuckerwerts. Die Autorin erklärt die Wahl des Themas aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen mit Diabetespatienten und der Bedeutung dieser Thematik für die Ausbildung von Pflegekräften. Die Bedingungsanalyse wird erläutert, die Sachanalyse, die Anleitungsplanung und Durchführung werden fiktiv dargestellt, und schließlich wird ein Fazit gezogen.
Bedingungsanalyse
Die Bedingungsanalyse befasst sich mit der Stations- und Arbeitssituation, der Analyse der Lernenden, dem Lerntyp der Lernenden und der Patientenanalyse. Die Station, die neurochirurgische Normalstation der Uniklinik Münster, wird beschrieben. Die Lernende, Fr. D., eine 41-jährige Frau mit einer Sozialwesen-Ausbildung, die sich am Ende ihres ersten Ausbildungsjahres befindet, wird vorgestellt. Ihre Lernfähigkeiten und ihr Lerntyp werden analysiert. Der Patient Hr. G., ein 49-jähriger Patient nach einer Bandscheibenvorfall-Operation mit Diabetes mellitus Typ 2, wird vorgestellt.
Sachanalyse
Die Sachanalyse umfasst die Inhaltsanalyse und die Lernzielformulierung. Die Inhalte der Praxisanleitung, wie die korrekte Messung des Blutzuckers und die Interpretation der Ergebnisse, werden analysiert. Die Lernziele, aufgeteilt in Richtziel, Grobziel und Feinziel, werden formuliert.
Anleitungsplanung
In der Anleitungsplanung werden die Voraussetzungen, die Methoden- und Medienauswahl, die Umsetzung der Vier-Stufen-Methode und die Aufgabenplanung des Praxisanleiters erläutert. Die erforderlichen Voraussetzungen für die Anleitung werden betrachtet, geeignete Methoden und Medien werden ausgewählt, und die Vier-Stufen-Methode wird als Anleitungsmodell eingesetzt. Die Aufgaben des Praxisanleiters während der Anleitung werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Praxisanleitung, Blutzuckermessung, Diabetes mellitus, Pflege, Lernende, Anleitungsmethoden, Vier-Stufen-Methode, Patientenanalyse, Stations- und Arbeitssituation.
Details
- Titel
- Praktische Anleitung zur Blutzuckermessung (Unterweisung Pflegefachkraft, 1. Ausbildungsjahr)
- Autor
- Katja Heinrich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Seiten
- 20
- Katalognummer
- V1337197
- ISBN (Buch)
- 9783346837622
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- praktische anleitung blutzuckermessung unterweisung pflegefachkraft ausbildungsjahr
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 16,99
- Arbeit zitieren
- Katja Heinrich (Autor:in), 2023, Praktische Anleitung zur Blutzuckermessung (Unterweisung Pflegefachkraft, 1. Ausbildungsjahr), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.unterweisungen.de/document/1337197
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
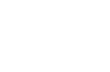
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-