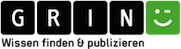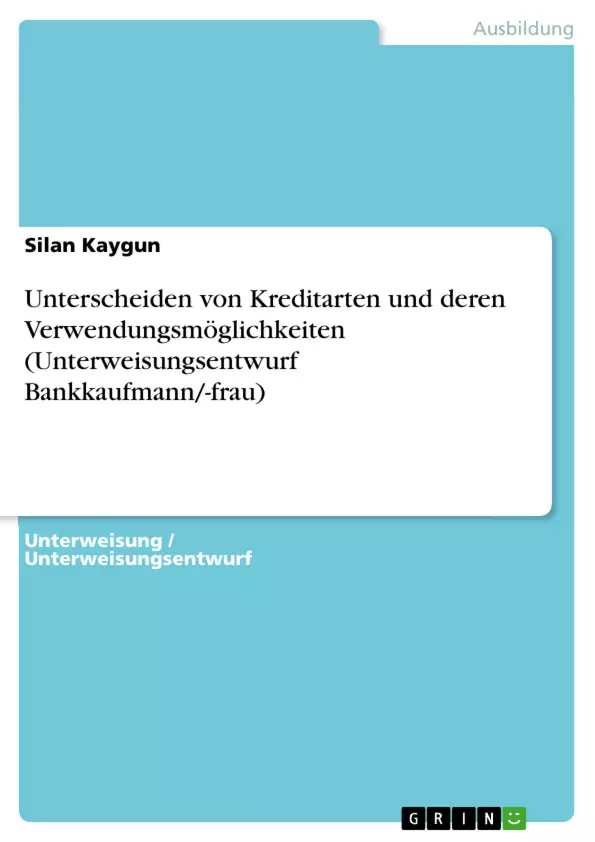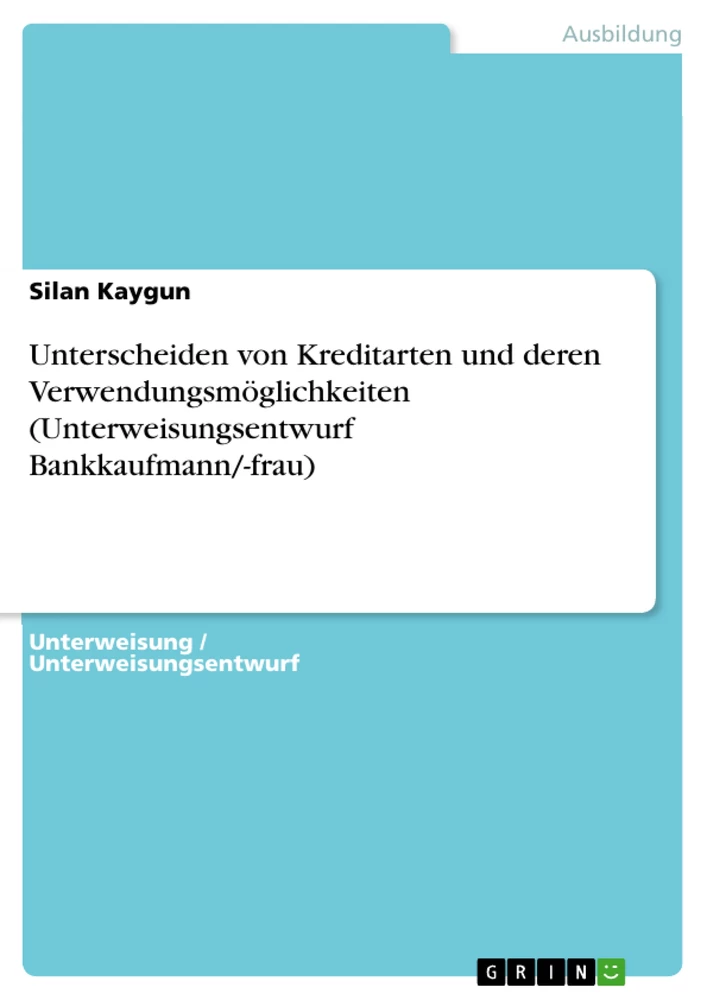
Unterscheiden von Kreditarten und deren Verwendungsmöglichkeiten (Unterweisungsentwurf Bankkaufmann/-frau)
Unterweisung / Unterweisungsentwurf, 2022
46 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Gender Erklärung
- 1. Ausgangsanalyse/Adressatenanalyse
- 1.1 Angaben zur/zum Auszubildenden
- 1.2 Angaben zum Ausbildungsbetrieb und zur Ausbilderin bzw. zum Ausbilder
- 1.3 Lernausgangslage
- 1.4 Lernzeit
- 1.5 Lernort
- 2. Didaktische Entscheidung
- 2.1 Sachanalyse
- 2.2 Rechtliche Verankerung
- 2.3 Strukturierung der Lernziele
- 2.3.1 Richtlernziele
- 2.3.2 Groblernziele
- 2.3.3 Feinlernziele (kognitiv, affektiv, psychomotorisch)
- 2.4 Lernzielkontrolle
- 3. Methodik und didaktischer Aufbau
- 3.1 Wahl und Begründung der Lernmethode
- 3.2 Einzusetzende Lehr- bzw. Lernmittel
- 4. Ablauf der Ausbildungssituation
- 5. Lernzielkontrolle
- Literaturverzeichnis
- Anhangsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterweisung zielt darauf ab, die Auszubildende in das Anbieten von Konsumentenkrediten und die Vorbereitung von Abschlüssen einzuführen. Sie soll die verschiedenen Kreditarten und deren Verwendungsmöglichkeiten verstehen und diese kompetent in Kundengesprächen einsetzen können.
- Verschiedene Kreditarten und deren Eigenschaften
- Anwenden des Wissens in praktischen Kundensituationen
- Entwicklung von Beratungskompetenzen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Kreditvergabe
- Sicherung der Liquidität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterweisung beginnt mit einer detaillierten Analyse der Adressaten (Auszubildende, Ausbildungsbetrieb und Ausbilderin). Die Lernausgangslage der Auszubildenden wird anhand ihrer bisherigen Ausbildungserfahrungen und ihres Wissensstandes beschrieben.
Im zweiten Kapitel werden die didaktischen Entscheidungen erläutert, die für die Unterweisung getroffen wurden. Hierbei werden die Sachanalyse, die rechtliche Verankerung und die Strukturierung der Lernziele (Richt-, Grob- und Feinlernziele) behandelt. Die Lernzielkontrolle wird als integraler Bestandteil des Lernprozesses vorgestellt.
Im dritten Kapitel werden die gewählte Lernmethode, das Lehrgespräch, sowie die verwendeten Lehr- und Lernmittel erläutert. Die Methode wird im Detail dargestellt und mit der Leittextmethode verglichen. Die Vorteile des Lehrgesprächs für die Förderung der Lernmotivation und der aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema werden hervorgehoben.
Das vierte Kapitel beschreibt den konkreten Ablauf der Unterweisungssituation, welche in fünf Phasen strukturiert ist.
Schlüsselwörter
Die Unterweisung befasst sich mit dem Thema Konsumentenkredite im Kontext der Berufsausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau. Wichtige Schlüsselwörter sind Kreditarten, wie Rahmenkredit, Ratenkredit und Dispositionskredit, Kundengespräche, Beratungskompetenz, rechtliche Rahmenbedingungen, Liquidität, Lernzielkontrolle und Lehrgespräch.
Häufig gestellte Fragen
Welche Kreditarten werden in der Banklehre unterschieden?
Zu den wichtigsten Konsumentenkrediten gehören der Ratenkredit, der Rahmenkredit und der Dispositionskredit.
Was ist das Ziel der Unterweisung für Bankkaufleute?
Auszubildende sollen die Fachkompetenz erwerben, Kreditarten bedürfnisgerecht zu erklären, Vor- und Nachteile abzuwägen und Kundenabschlüsse vorzubereiten.
Welche Methode wird in diesem Unterweisungsentwurf genutzt?
Es wird das Lehrgespräch gewählt, da es die aktive Auseinandersetzung fördert und die Lernmotivation der Auszubildenden steigert.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind bei der Kreditvergabe wichtig?
Dazu gehören die Prüfung der Kreditwürdigkeit, die Einhaltung von Verbraucherschutzrechten und die Sicherung der Liquidität des Kunden.
Wie wird der Lernerfolg der Auszubildenden kontrolliert?
Die Lernzielkontrolle erfolgt durch praktische Übungen, Transferfragen und die Anwendung des Wissens in simulierten Kundengesprächen.
Details
- Titel
- Unterscheiden von Kreditarten und deren Verwendungsmöglichkeiten (Unterweisungsentwurf Bankkaufmann/-frau)
- Hochschule
- Fachhochschule Dortmund
- Note
- 1,0
- Autor
- Silan Kaygun (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2022
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V1349765
- ISBN (Buch)
- 9783346862587
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ausbildereignungsschein Ausbilder Bankkaufmann Bankkauffrau Berufsausbildung Unterweisung AES
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Silan Kaygun (Autor:in), 2022, Unterscheiden von Kreditarten und deren Verwendungsmöglichkeiten (Unterweisungsentwurf Bankkaufmann/-frau), München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.unterweisungen.de/document/1349765
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
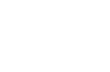
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-