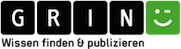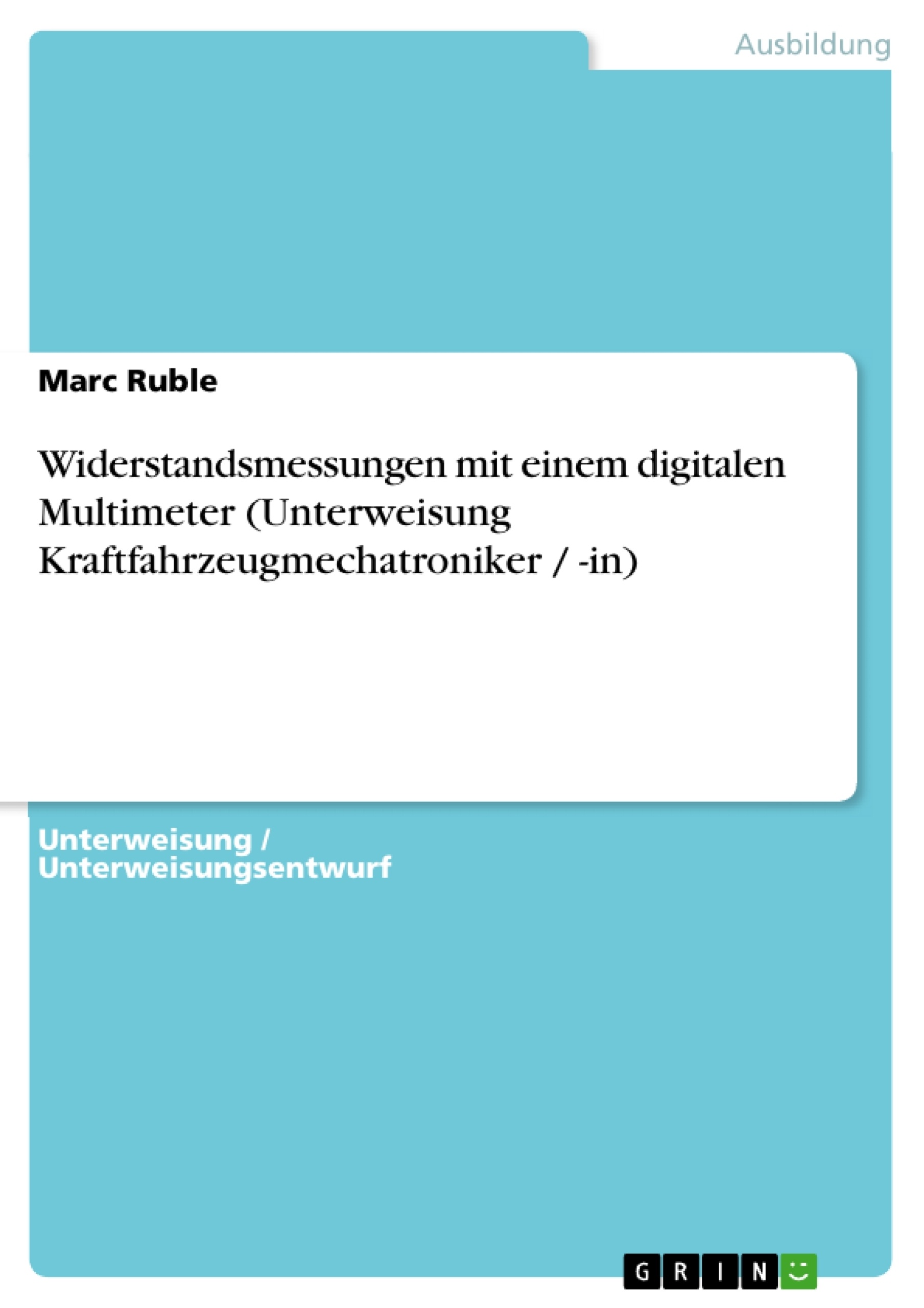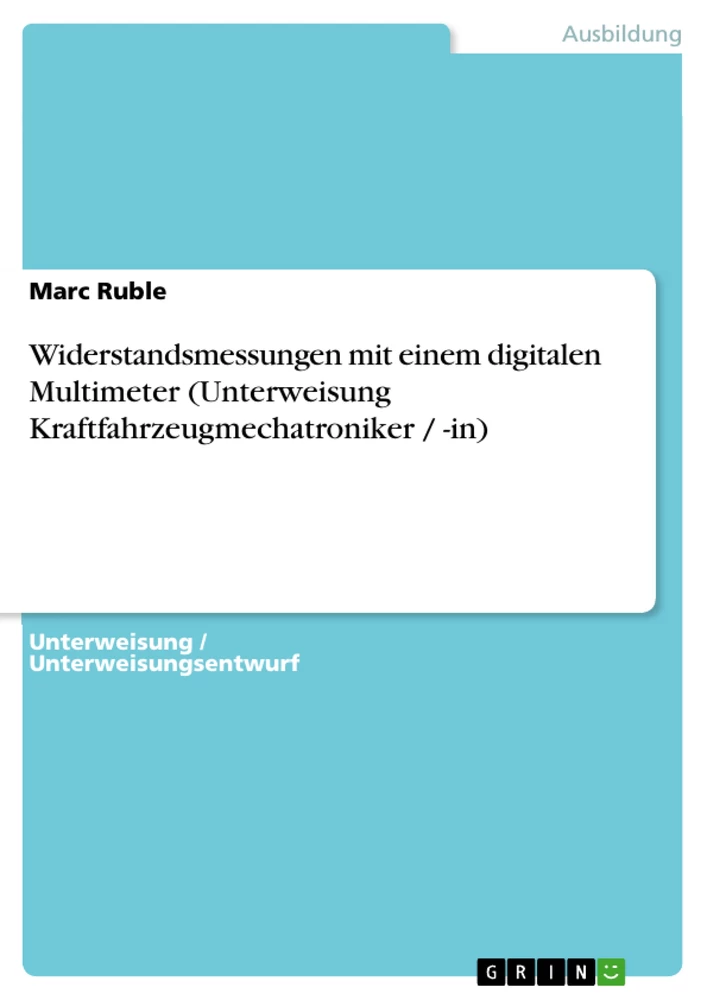
Widerstandsmessungen mit einem digitalen Multimeter (Unterweisung Kraftfahrzeugmechatroniker / -in)
Unterweisung / Unterweisungsentwurf, 2007
18 Seiten, Note: gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Zielgruppe
- Alter und schulische Vorbildung
- Entwicklungsstand
- Ausbildungsstand
- Didaktische Analyse
- Ausbildungsrahmenplan
- Betrieblicher Ausbildungsplan
- Fachlicher Inhalt
- Thema der vorangegangenen Unterweisung
- Thema der nachfolgenden Unterweisung.
- Bedeutung für die (den) Auszubildende(n)
- Kooperation mit dem Berufskolleg
- Lernfeldorientierung
- Lernzielarten
- Leitlernziel
- Richtlernziel
- Groblernziel
- Feinlernziele
- Kognitive Feinlernziele
- Affektive Feinlernziele
- Psychomotorische Feinlernziele
- Lernzieloperationalisierung
- Lernzielkontrolle
- Lernzielbereiche
- Kognitiver Lernzielbereich (Kopf)
- Affektiver Lernzielbereich (Herz)
- Psychomotorischer Lernzielbereich (Hand)
- Qualifikationen
- Kernqualifikationen
- Schlüsselqualifikationen
- Kompetenzen
- Handlungskompetenz
- Fachkompetenz
- Human- (Selbst) kompetenz
- Sozialkompetenz
- Methodenkompetenz
- Lernkompetenz
- Medienkompetenz
- Lernzielstufen
- Taxonomie nach Bloom
- Taxonomie nach IHKT-Empfehlung
- Organisation der Unterweisung
- Lernort
- Ausbildungsmittel
- Tag und Tageszeit der Unterweisung
- Arbeitsergonomie
- Unfallverhütung
- Umweltschutz
- Geplanter Unterweisungsverlauf
- Unterweisungsdauer
- Methodische Prinzipien
- Durchführung der Unterweisung
- 1.Stufe: Vorbereitung und Motivation
- 2.Stufe: Vormachen und erklären
- 3.Stufe: Ausführungsversuche machen lassen
- 4.Stufe: Üben und Festigen
- Kontrolle des Ausbildungserfolges
- Selbstkontrolle durch den Auszubildenden
- Fremdkontrolle durch den Ausbilder
- Literatur- und Quellennachweis
- Hinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterweisungsentwurf zielt darauf ab, Auszubildenden im Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker/in die Fähigkeit zu vermitteln, Widerstandsmessungen mit einem digitalen Multimeter durchzuführen. Der Entwurf basiert auf der Vier-Stufen-Methode der Arbeitsunterweisung und soll den Auszubildenden in die Lage versetzen, die Funktionsweise des Multimeters zu verstehen, Messungen korrekt durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren.
- Grundlegendes Verständnis der Funktionsweise eines digitalen Multimeters
- Korrekte Anwendung des Multimeters für Widerstandsmessungen
- Interpretation der Messergebnisse
- Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit elektrischen Geräten
- Praktische Anwendung des erlernten Wissens in realen Arbeitssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Unterweisungsentwurf beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Zielgruppe, die sich auf den Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker/in konzentriert. Es werden Informationen über das Alter, die schulische Vorbildung, den Entwicklungsstand und den Ausbildungsstand des Auszubildenden bereitgestellt.
Die didaktische Analyse beleuchtet den Ausbildungsrahmenplan und den betrieblichen Ausbildungsplan, um den fachlichen Kontext der Unterweisung zu verdeutlichen. Der Entwurf geht auf die Bedeutung des Themas für die Auszubildenden ein und beschreibt die Kooperation mit dem Berufskolleg.
Im Abschnitt über die Lernzielarten werden verschiedene Lernziele definiert, darunter Leitlernziel, Richtlernziel, Groblernziel und Feinlernziele. Die Feinlernziele werden in kognitive, affektive und psychomotorische Ziele unterteilt. Die Lernzieloperationalisierung und -kontrolle werden ebenfalls erläutert.
Der Entwurf definiert die Lernzielbereiche, die sich auf den kognitiven, affektiven und psychomotorischen Bereich konzentrieren. Die Qualifikationen, die in der Unterweisung vermittelt werden sollen, werden in Kernqualifikationen und Schlüsselqualifikationen unterteilt.
Der Abschnitt über Kompetenzen behandelt die Handlungskompetenz, die sich aus Fachkompetenz, Human- (Selbst) kompetenz und Sozialkompetenz zusammensetzt. Weitere Kompetenzen, die im Entwurf behandelt werden, sind Methodenkompetenz, Lernkompetenz und Medienkompetenz.
Der Entwurf beschreibt die Lernzielstufen nach Bloom und nach der IHKT-Empfehlung. Die Organisation der Unterweisung umfasst den Lernort, die Ausbildungsmittel, den Tag und die Tageszeit der Unterweisung, Arbeitsergonomie, Unfallverhütung und Umweltschutz.
Der geplante Unterweisungsverlauf beinhaltet die Unterweisungsdauer, methodische Prinzipien und die Durchführung der Unterweisung in vier Stufen: Vorbereitung und Motivation, Vormachen und erklären, Ausführungsversuche machen lassen und Üben und Festigen.
Der Entwurf schließt mit der Kontrolle des Ausbildungserfolges, die sowohl die Selbstkontrolle durch den Auszubildenden als auch die Fremdkontrolle durch den Ausbilder umfasst.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Widerstandsmessungen, digitales Multimeter, Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Ausbildung, Unterweisung, Vier-Stufen-Methode, Lernziele, Kompetenzen, Organisation der Unterweisung, Kontrolle des Ausbildungserfolges.
Details
- Titel
- Widerstandsmessungen mit einem digitalen Multimeter (Unterweisung Kraftfahrzeugmechatroniker / -in)
- Note
- gut
- Autor
- Marc Ruble (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 18
- Katalognummer
- V149340
- ISBN (eBook)
- 9783640646395
- ISBN (Buch)
- 9783656899303
- Dateigröße
- 522 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kraftfahrzeugmechatroniker Elektrik KFZ Unterweisung Unterweisungsentwurf Widerstände Messung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 14,99
- Preis (Book)
- US$ 19,99
- Arbeit zitieren
- Marc Ruble (Autor:in), 2007, Widerstandsmessungen mit einem digitalen Multimeter (Unterweisung Kraftfahrzeugmechatroniker / -in) , München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.unterweisungen.de/document/149340
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen
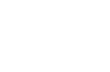
- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-